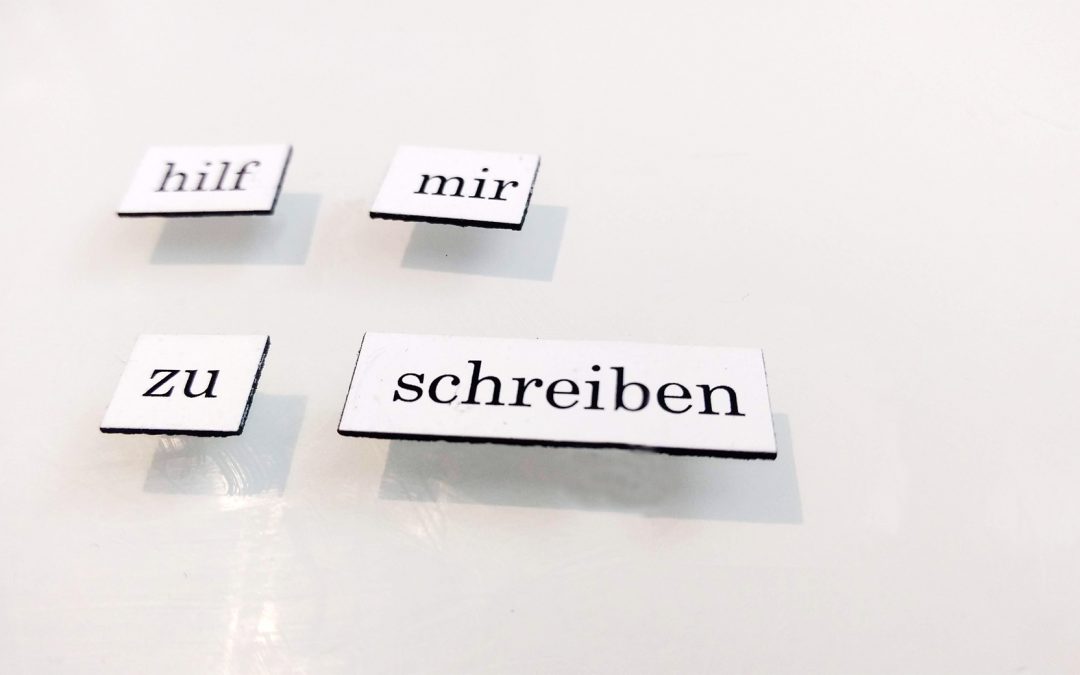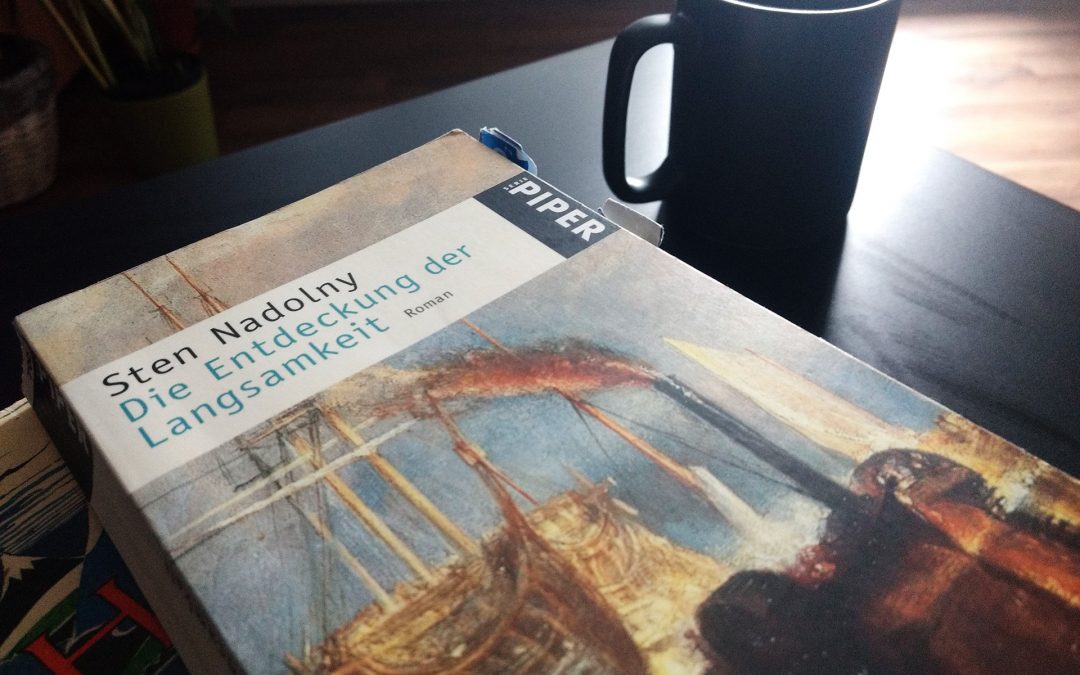Was ist wahr und was Traum? – Alice in Wonderland
Ein weiterer Ehrenplatz in meinem Bücherregal ist für Lewis Carroll reserviert. Kaum ein Text lebt so vom Spaß an Wortspielereien wie „Alice in Wonderland“. Und kaum ein Text inspiriert mich so sehr in meiner Arbeit.
Als Journalistin sollte ich mich stets an die harten Fakten halten. Jedes Wort einer Pressemitteilung gehört geprüft, jede Aussage eines Gesprächspartners hinterfragt. Das ist das Handwerkszeug, die Fähigkeit, nicht auf Floskeln und rhetorische Stilmittel hereinzufallen. Doch manchmal ist das gar nicht so leicht.
Worte, egal ob gesprochen oder geschrieben, sind Ausdrucksbilder. Ihre Anordnung, der Kontext, in dem sie geäußert werden, ihre Betonung bieten dem Wahrnehmenden Raum zur Interpretation. Und wo interpretiert wird, gibt es keine Eindeutigkeit.
Eine Spielwiese für Wortliebhaber ist für mich das Buch „Alice in Wonderland“ von Lewis Carroll, oder Charles Lutwidge Dodgson, wie der Autor mit bürgerlichem Namen hieß. Ein Mathematiker, der die Exaktheit der Zahlen und die Ungenauigkeit der Worte in einem Werk zusammenbrachte. Auf den ersten Blick eine Kindergeschichte sind die Abenteuer von Alice auf den zweiten Blick Geschichten, die aus sehr vielen Ebenen bestehen. Ein Lehrbuch für Sprache, ein Spiel mit der Wirklichkeit, eine philosophische Abhandlung darüber, wer wir sind. Ein Buch, in dem man mit jedem Blick etwas Neues entdeckt.
Wer bin ich?
„Who are you“, wird Alice gleich zu Beginn ihrer Reise von einer Raupe gefragt, dem Caterpillar. Ja, wer ist sie denn? Ein Mädchen, eine Tochter ihrer Eltern, eine Rebellin, Erfinderin. Doch das Wunderland mit seinen Regeln lässt sie die Regeln ihrer Welt hinterfragen. Erst normalgroß, dann klein, dann wieder riesig wechselt sie ständig die Größe und damit auch die Perspektive auf ihre Umgebung. Wer ich bin, hängt davon ab, welche Perspektive ich einnehme. Das gilt für Journalisten wie Autoren. Die Worte, die ich nutze, müssen im Kontext meiner Perspektive wahrgenommen werden, um zu erahnen, was ich meine.
So startet die Reise von Alice durch die Selbstfindung. Eine Traumreise, oder ist es kein Traum?, die verrückter nicht sein kann. „‚I can’t explain myself, I’m afraid, sir,‘ said Alice, ‚because I’m not myself, you see.‘ ‚I don’t see,‘ said the Caterpillar.“ Wie auch. Er sieht ja nur die Alice aus diesem einen Moment, die gerade vor ihm steht, was den Floskelnachsatz ad absurdum führt. Das Stilmittel nutzt Caroll immer wieder, lässt seine Charaktere jedes Wort auf die Goldwaage legen, um liebgewonnene Redewendungen zu enttarnen.

Foto: Mariana Friedrich, Illustrationen im Buch: Duŝan Kállay
„Then you should say what you mean“
Eines der bekanntesten Kapitel der Geschichte ist sicherlich die Teeparty des Märzhasen, des verrückten Hutmachers und des Siebenschläfers oder der Haselmaus. Mit „Why is a raven like a writing desk?“ stellt der Hutmacher ein unlösbares Rätsel, das Alice sofort zu raten beginnen möchte. Zu raten und die Antwort auf eine Frage zu finden, sind zwei verschiedene Dinge, weshalb der Märzhase nachfragt, was sie meint und sie anschließend ermahnt, sie solle doch sagen, was sie meint, statt in Rätseln zu sprechen. Zu welch wundervollen Bildern es führt, wenn man diese Redewendungen zu wörtlich nimmt, stellt die anschließende Diskussion über Zeitverschwendung unter Beweis.
Alice ermahnt die Gruppe, die Zeit nicht mit Rätseln ohne Lösung zu verschwenden und ist erstaunt über die Korrektur, dass Zeit männlich ist, also nicht sie oder im Englischen it, sondern he oder er. Und er mag es gar nicht, wenn man ihn totschlägt oder schlägt (im Englischen lautet die Redewendung ‚to beat time‘, anders als das Deutsche ‚die Zeit totschlagen‘, wenn man sich langweilt).

Foto: Mariana Friedrich, Illustrationen im Buch: Duŝan Kállay
Stell dir das Unvorstellbare vor
Das sind nur zwei Beispiele dafür, warum „Alice in Wonderland“ eine Fundgrube für Autoren und Texter ist. Caroll dichtet Kinderreime um, arrangiert seine Worte zu Bildern, lässt aus Sprichworten Figuren entstehen und hält unserer Gesellschaft eulenspielesk den Spiegel vor. Vor allem aber fordert er die Fantasie heraus. Wenn er die Königin empört ausrufen lässt: „Why, sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast“ mit dem Zusatz, man müsse das nur genügend üben, gibt er seinen Lesern eine wichtige Aufgabe: Nutze deine Fantasie, denn sie ist das stärkste Instrument, das du besitzt.
Eine schöne Übung gerade für angehende Autoren, denn gerade in diesen Unmöglichkeiten, die wir uns vorstellen, findet sich in Kombination mit dem, was wir gut kennen, der Stoff für die schönsten Geschichten.
Ein Anmerkung zu den Illustrationen:
Ich habe für den Text nicht die klassischen und wunderschönen Zeichnungen von Sir John Tenniel verwendet, der Alice ihr Gesicht gegeben hat. Ich liebe seine Illustrationen. Seine Arbeit wird noch vielen Generationen von Kindern den Spaß an der Geschichte versüßen.
In diesem Blogbeitrag findet ihr Illustrationen von Duŝan Kállay, der Carolls Werk für den Altberliner Verlag in der Ausgabe von 1988 umgesetzt hat. Diese Version findet sich in meinem Bücherregal, denn mit ihr bin ich aufgewachsen, mit ihr habe ich die Welt von Lewis Caroll kennengelernt. Auf Pintrest finden sich noch viele weitere seiner Arbeiten.
Mehr zu Lewis Caroll:
Natürlich kann keiner dieser Blogbeiträge zu den Ehrenplätzen im Bücherregal die Tiefe der beschriebenen Werke auch nur ankratzen. Auf der Suche nach Ideen, welche Aspekte ich von Alice vorstellen möchte, habe ich einige Lektürefundgruben entdeckt, die spannende Interpretationen, wissenschaftliche Aufarbeitungen und Gedankenspiele bieten.
– Die British Library hat auf ihrer Webseite einen riesigen Fundus an Material zum Weiterlesen.
– Das Portal Mentalfloss hat spannende Fakten zu Lewis Caroll gesammelt, die vielleicht noch nicht jeder kennt.
– Tiefgründig und spannend arbeitet das alice-in-wonderland.net den Text auf.